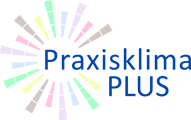Was verbirgt sich hinter dem Begriff Praxisklima?
Wir nähern uns der Bedeutung des Begriffs zunächst mit dem Blick von außen. Jeder kennt die Situation: Man betritt als Patient oder Besucher eine unbekannte Praxis und viele neue Reize des Praxisgeschehens und des menschlich-sozialen Umgangs wirken auf uns ein. Nach und nach entsteht in uns ganz unwillkürlich der Eindruck einer bestimmten positiven oder negativen Qualität des Klimas in dieser Praxis. Nehmen wir bspw. eine angespannte Atmosphäre wahr, stehen die Mitarbeiter unter Druck, wirken sie desorganisiert oder demotiviert, sind sie viel mit Problemen beschäftigt, nehmen wir im Team „Knirschen“ oder Konflikte wahr, interagieren Mitarbeiter mit uns unaufmerksam, unpersönlich oder gereizt usw. wird unser unwillkürlicher Eindruck in die negative Richtung ausschlagen. Auf ein besonders gutes Praxisklima schließen wir als Beobachter automatisch, wenn wir bspw. die Atmosphäre als entspannt und positiv-konzentriert empfinden, die Mitarbeiter motiviert, organisiert und kompetent agieren, das Team sozial harmoniert, unsere individuellen Bedürfnisse berücksichtigt und wir freundlich und respektvoll behandelt werden usw.
Die durch Patienten oder Besucher wahrgenommene praxistypische Klimaqualität ist so bedeutsam, weil sie die Außenwirkung der Praxis bestimmt: Sie ist ein zentraler Bestandteil des inneren Bildes, das Außenstehende von der Praxis entwickeln (Praxisimage). Wird das Praxisklima als negativ empfunden, wird auch die medizinisch-fachliche Kompetenz der Praxis negativer eingeschätzt. Gilt das Praxisklima nach außen hin als gut, macht das die Praxis für qualifizierte Bewerber deutlich attraktiver (Arbeitgeberattraktivität).
Der Blick von außen ist jedoch nur der Blick auf die sichtbaren Konsequenzen oder „Symptome“ des Praxisklimas: Ein freundlich-aufmerksames Lächeln oder reibungslose Abstimmungen sind beobachtbare Verhaltensausdrücke, von denen der Beobachter auf ein gutes Klima schließt. Erzeugt und aufrechterhalten wird das Praxisklima natürlich von den Menschen, die tagtäglich in der Praxis arbeiten. Das spezifische Klima einer Praxis beruht auf einer zeitstabilen spezifischen Qualität des Erlebens, der Einstellungen und damit verknüpfter Verhaltenstendenzen ihrer Mitarbeiter. Das ist der Blick von innen, den wir im Folgenden einnehmen.
Aus wissenschaftlicher Sicht stehen zwei Gefühlshaltungen (affektive Einstellungen) der Praxismitarbeiter im Zentrum des Praxisklimas: Arbeitszufriedenheit (bzw. -unzufriedenheit) und emotionale Bindung (Forschungsbegriff: affektives Commitment). Zusammengenommen bezeichne ich diesen emotionalen Kern des Praxisklimas als "affektives Klima". Einfach ausgedrückt: Ein gutes Praxisklima wird getragen von Mitarbeitern, die mit ihrer Arbeit und den Arbeitsbedingungen zufrieden sind und sich mit der Praxis und ihren Zielen emotional verbunden fühlen. Arbeitszufriedenheit und emotionale Bindung sind demnach die hauptsächlichen inneren, "affektiven Motoren“ für die nach außen sichtbaren "Symptome“ des Praxisklimas. Beide Einstellungen überlappen sich in ihren Ursachen und Konsequenzen stark, so dass man sie sich als eine Art "Tandem" vorstellen kann.
Die durch Patienten oder Besucher wahrgenommene praxistypische Klimaqualität ist so bedeutsam, weil sie die Außenwirkung der Praxis bestimmt: Sie ist ein zentraler Bestandteil des inneren Bildes, das Außenstehende von der Praxis entwickeln (Praxisimage). Wird das Praxisklima als negativ empfunden, wird auch die medizinisch-fachliche Kompetenz der Praxis negativer eingeschätzt. Gilt das Praxisklima nach außen hin als gut, macht das die Praxis für qualifizierte Bewerber deutlich attraktiver (Arbeitgeberattraktivität).
Der Blick von außen ist jedoch nur der Blick auf die sichtbaren Konsequenzen oder „Symptome“ des Praxisklimas: Ein freundlich-aufmerksames Lächeln oder reibungslose Abstimmungen sind beobachtbare Verhaltensausdrücke, von denen der Beobachter auf ein gutes Klima schließt. Erzeugt und aufrechterhalten wird das Praxisklima natürlich von den Menschen, die tagtäglich in der Praxis arbeiten. Das spezifische Klima einer Praxis beruht auf einer zeitstabilen spezifischen Qualität des Erlebens, der Einstellungen und damit verknüpfter Verhaltenstendenzen ihrer Mitarbeiter. Das ist der Blick von innen, den wir im Folgenden einnehmen.
Aus wissenschaftlicher Sicht stehen zwei Gefühlshaltungen (affektive Einstellungen) der Praxismitarbeiter im Zentrum des Praxisklimas: Arbeitszufriedenheit (bzw. -unzufriedenheit) und emotionale Bindung (Forschungsbegriff: affektives Commitment). Zusammengenommen bezeichne ich diesen emotionalen Kern des Praxisklimas als "affektives Klima". Einfach ausgedrückt: Ein gutes Praxisklima wird getragen von Mitarbeitern, die mit ihrer Arbeit und den Arbeitsbedingungen zufrieden sind und sich mit der Praxis und ihren Zielen emotional verbunden fühlen. Arbeitszufriedenheit und emotionale Bindung sind demnach die hauptsächlichen inneren, "affektiven Motoren“ für die nach außen sichtbaren "Symptome“ des Praxisklimas. Beide Einstellungen überlappen sich in ihren Ursachen und Konsequenzen stark, so dass man sie sich als eine Art "Tandem" vorstellen kann.
Welche Konsequenzen hat ein gutes oder schlechtes Praxisklima?
Arbeitszufriedenheit und emotionale Bindung der Mitarbeiter sorgen also für ein hervorragendes, ein mittelprächtiges oder ein eingetrübtes Praxisklima mit allen entsprechenden Konsequenzen. Jahrzehntelange Forschung zeigt, dass hohe Arbeitszufriedenheit und eine starke emotionale Bindung die mit (sehr weitem) Abstand besten Prädiktoren für die folgenden positiven Verhaltenstendenzen und betrieblichen Erfolgsfaktoren sind:
Intrinsische Arbeitsmotivation und freiwilliges Engagement
Körperliches und psychisches Wohlbefinden
Leistungs- und Veränderungsbereitschaft
Serviceorientierung und Kundenzufriedenheit (Patientenzufriedenheit)
Geringe Kündigungsabsicht und geringe Fluktuation
Unternehmensfürsprache (Praxisfürsprache) und Weiterempfehlung als Arbeitgeber
Attraktivität als Arbeitgeber
Geringe Zufriedenheit und schwache Bindung der Mitarbeiter verschlechtern das Praxisklima und beeinflussen die aufgelisteten Erfolgsfaktoren negativ. So sind eher unzufriedene und schwach gebundene Mitarbeiter bspw. kaum intrinsisch motiviert und tragen sich mit Kündigungsabsichten.
Wie entsteht ein gutes oder schlechtes Praxisklima?
Da Arbeitszufriedenheit und emotionale Mitarbeiterbindung für das Praxisklima verantwortlich sind, müssen wir uns zur Beantwortung dieser Frage den Ursachen dieser Einstellungen zuwenden: Was sorgt eigentlich dafür, dass die Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen und sich mit der Praxis positiv verbunden fühlen? Und was führt dazu, dass Mitarbeiter mit ihrer Arbeit unzufrieden sind und die innere Bindung zur Praxis schwindet?
Die Bildung dieser Einstellungen kann man sich als einen permanenten, unwillkürlich ablaufenden Prozess vorstellen: Die Mitarbeiter nehmen eine Vielzahl von Arbeits- und Praxismerkmalen (und ihre Veränderungen) fortlaufend wahr und bewerten diese auf emotionaler Ebene unwillkürlich positiv oder negativ. Alle emotionalen Einzelbewertungen fließen ein in die affektiven Haltungen der Zufriedenheit mit der Arbeit und der Verbundenheit mit der Praxis. Diese bestimmen wiederum das Praxisklima mit den gerade beschriebenen Konsequenzen. Im Zeitverlauf entwickeln sich die Einstellungen auf etwas unterschiedliche Weise: Arbeitszufriedenheit ist sensibler für die aktuelle Arbeits- und Praxissituation und kann schnelleren Schwankungen unterliegen, während sich die emotionale Bindung der Mitarbeiter an die Praxis kontinuierlicher über einen längeren Zeitraum aufbaut und sich gegen aktuelle Einflüsse relativ robust zeigt.
Die wissenschaftliche Forschung zu den Ursachen von Arbeitszufriedenheit und emotionaler Bindung blickt auf eine lange Geschichte zurück und hat eine Vielzahl von Faktoren identifiziert, die diese affektiven Einstellungen der Mitarbeiter positiv oder negativ beeinflussen. Hier nur wenige prägnante Beispiele:
Die Bildung dieser Einstellungen kann man sich als einen permanenten, unwillkürlich ablaufenden Prozess vorstellen: Die Mitarbeiter nehmen eine Vielzahl von Arbeits- und Praxismerkmalen (und ihre Veränderungen) fortlaufend wahr und bewerten diese auf emotionaler Ebene unwillkürlich positiv oder negativ. Alle emotionalen Einzelbewertungen fließen ein in die affektiven Haltungen der Zufriedenheit mit der Arbeit und der Verbundenheit mit der Praxis. Diese bestimmen wiederum das Praxisklima mit den gerade beschriebenen Konsequenzen. Im Zeitverlauf entwickeln sich die Einstellungen auf etwas unterschiedliche Weise: Arbeitszufriedenheit ist sensibler für die aktuelle Arbeits- und Praxissituation und kann schnelleren Schwankungen unterliegen, während sich die emotionale Bindung der Mitarbeiter an die Praxis kontinuierlicher über einen längeren Zeitraum aufbaut und sich gegen aktuelle Einflüsse relativ robust zeigt.
Die wissenschaftliche Forschung zu den Ursachen von Arbeitszufriedenheit und emotionaler Bindung blickt auf eine lange Geschichte zurück und hat eine Vielzahl von Faktoren identifiziert, die diese affektiven Einstellungen der Mitarbeiter positiv oder negativ beeinflussen. Hier nur wenige prägnante Beispiele:
Psychische Belastungen bei der Arbeit wie häufiger Zeitdruck oder Erholungsmangel werden als starker Stress empfunden, schwächen Arbeitszufriedenheit und emotionale Bindung und verschlechtern das Praxisklima. Demgegenüber verstärken verschiedene positive Arbeitsanforderungen wie bspw. herausfordernde Aufgaben oder ein ausreichender Handlungsspielraum die affektiven Einstellungen und fördern das Praxisklima.
Hat ein Team eine gemeinsame Zielorientierung (z. B. Klarheit über Ziele und Aufgaben) und eine gute Beziehungsqualität entwickelt (z. B. offene Teamkommunikation) stärkt dies Zufriedenheit und emotionale Bindung und fördert das Praxisklima.
Bestimmte Elemente des Führungsverhaltens schwächen Arbeitszufriedenheit und emotionale Bindung der Mitarbeiter, während andere Elemente sie positiv verstärken und zu einem guten Praxisklima beitragen. So erweist sich beispielsweise das (explizite) Fordern und Fördern von hohem Engagement und guter Leistung generell als klimaförderlich.
Wie kann man das Praxisklima messen und positiv beeinflussen?
Ich habe dargelegt, dass Arbeitszufriedenheit und emotionale Bindung die "affektiven Motoren“ sind, die im Tandem die Praxisklima-qualität bestimmen: Sind beide affektiven Einstellungen hoch ausgeprägt ist das Praxisklima entsprechend gut und umgekehrt. Zusammengenommen bezeichne ich diesen emotionalen Kern des Praxisklimas als "affektives Klima". Möchte man also für die aktuelle Praxisklimaqualität einen Wert bestimmen, bietet der Wert für das affektive Klima die wohl beste Annäherung. Ein Praxisklima-Gesamtwert ist wichtig, um die Entwicklung des Klimas über die Zeit zu verfolgen. Wenn man Maßnahmen ergreift, um das Praxisklima zu verbessern, dient er der Überprüfung des Maßnahmenerfolges.
Da in diesen Gesamtwert viele emotionale Einzelbewertungen einfließen, bietet er für sich genommen keinen konkreten Anhaltspunkt, wie man das Praxisklima in eine positive Richtung verändern kann. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir uns dafür die konkreten praxisspezifischen Ursachen von Arbeitszufriedenheit und emotionaler Bindung ansehen müssen. Welche Faktoren sind es, die von den Mitarbeitern einer bestimmten Praxis positiv erlebt werden und zu einem guten affektiven Klima beitragen (Klimastärken) und welche konkreten Faktoren werden negativ erlebt und verschlechtern das affektive Klima (Klimaschwächen)?
Weiter oben habe ich nur wenige Faktoren aufgezählt, die nach wissenschaftlichem Forschungsstand ursächlich zu einem guten oder schlechten affektiven Klima beitragen. Insgesamt hat man jedoch eine recht hohe Zahl unterschiedlicher Einflussfaktoren gefunden. Etwas übersichtlicher und handhabbarer wird es, wenn man diese Faktoren inhaltlichen Themengruppen zuordnet. So beziehen sich bspw. einige der klimarelevanten Faktoren auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter, manche kann man thematisch dem direkten Führungsverhalten zuordnen, andere wiederum der Mitarbeiterinformation und -kommunikation. Ich bezeichne diese klimarelevanten Themenbereiche als Klimadimensionen. So ergeben sich in meinem forschungsgeleiteten Modell insgesamt sieben Klimadimensionen, die das gesamte Spektrum der bekannten klimarelevanten Faktoren abdecken und das affektive Klima - als achte und Kerndimension - bestimmen (siehe die grafische Darstellung).
Wenn man das Praxisklima gezielt und wirksam verbessern möchte, benötigt man eine vollständige und genaue Klimadiagnostik.
Die verbreiteten, üblichen Mitarbeiterbefragungen sind dafür nicht geeignet, weil sie nicht für diese Aufgabe konstruiert wurden und (wenn überhaupt) nur einen Bruchteil der wichtigen klimarelevanten Faktoren erfassen. Zielgenaue Klimaverbesserungen lassen sich nur mit einer systematischen Betriebsklimaanalyse erreichen, wie ich sie mit der Praxisklima-PLUS-Analyse für den Bereich von Arzt- und Zahnarztpraxen anbiete. Das damit gewonnene, vollständige und detaillierte Bild der etwa 100 positiven und negativen Einfluss-faktoren des individuellen Praxisklimas macht es möglich, ein motivierendes Bewusstsein über die Klimastärken der Praxis zu gewinnen und aus konkreten Klimaschwächen konkrete Entwicklungsmaßnahmen abzuleiten, die das Praxisklima auch tatsächlich wirksam verbessern können.
Da in diesen Gesamtwert viele emotionale Einzelbewertungen einfließen, bietet er für sich genommen keinen konkreten Anhaltspunkt, wie man das Praxisklima in eine positive Richtung verändern kann. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir uns dafür die konkreten praxisspezifischen Ursachen von Arbeitszufriedenheit und emotionaler Bindung ansehen müssen. Welche Faktoren sind es, die von den Mitarbeitern einer bestimmten Praxis positiv erlebt werden und zu einem guten affektiven Klima beitragen (Klimastärken) und welche konkreten Faktoren werden negativ erlebt und verschlechtern das affektive Klima (Klimaschwächen)?
Weiter oben habe ich nur wenige Faktoren aufgezählt, die nach wissenschaftlichem Forschungsstand ursächlich zu einem guten oder schlechten affektiven Klima beitragen. Insgesamt hat man jedoch eine recht hohe Zahl unterschiedlicher Einflussfaktoren gefunden. Etwas übersichtlicher und handhabbarer wird es, wenn man diese Faktoren inhaltlichen Themengruppen zuordnet. So beziehen sich bspw. einige der klimarelevanten Faktoren auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter, manche kann man thematisch dem direkten Führungsverhalten zuordnen, andere wiederum der Mitarbeiterinformation und -kommunikation. Ich bezeichne diese klimarelevanten Themenbereiche als Klimadimensionen. So ergeben sich in meinem forschungsgeleiteten Modell insgesamt sieben Klimadimensionen, die das gesamte Spektrum der bekannten klimarelevanten Faktoren abdecken und das affektive Klima - als achte und Kerndimension - bestimmen (siehe die grafische Darstellung).
Wenn man das Praxisklima gezielt und wirksam verbessern möchte, benötigt man eine vollständige und genaue Klimadiagnostik.
Die verbreiteten, üblichen Mitarbeiterbefragungen sind dafür nicht geeignet, weil sie nicht für diese Aufgabe konstruiert wurden und (wenn überhaupt) nur einen Bruchteil der wichtigen klimarelevanten Faktoren erfassen. Zielgenaue Klimaverbesserungen lassen sich nur mit einer systematischen Betriebsklimaanalyse erreichen, wie ich sie mit der Praxisklima-PLUS-Analyse für den Bereich von Arzt- und Zahnarztpraxen anbiete. Das damit gewonnene, vollständige und detaillierte Bild der etwa 100 positiven und negativen Einfluss-faktoren des individuellen Praxisklimas macht es möglich, ein motivierendes Bewusstsein über die Klimastärken der Praxis zu gewinnen und aus konkreten Klimaschwächen konkrete Entwicklungsmaßnahmen abzuleiten, die das Praxisklima auch tatsächlich wirksam verbessern können.
Das Praxisklima lässt sich nur in einem offen-konstruktiven, dialogischen Prozess mit den Mitarbeitern verbessern. Neben der geeigneten Diagnostik ist deshalb das offene und vertrauensvolle Mitwirken der Mitarbeiter der wichtigste Erfolgsfaktor. Eine externe fachliche Begleitung kann die Praxis wirksam unterstützen, die notwendige Transparenz herzustellen, Vertrauen zu fördern und alle Teammitglieder aktiv und konstruktiv in den gemeinschaftlichen Prozess der Verbesserung des Praxisklimas einzubeziehen.
Sie haben eine Frage oder möchten ein unverbindliches Angebot erhalten?